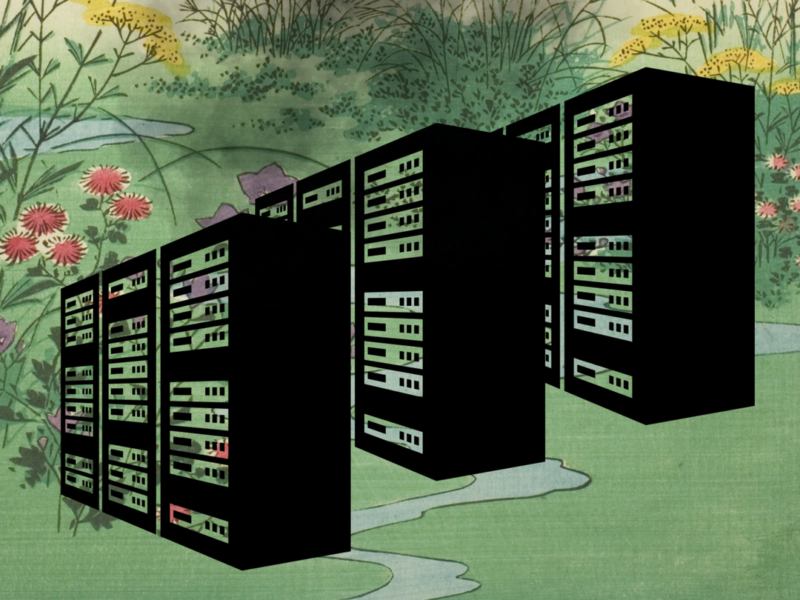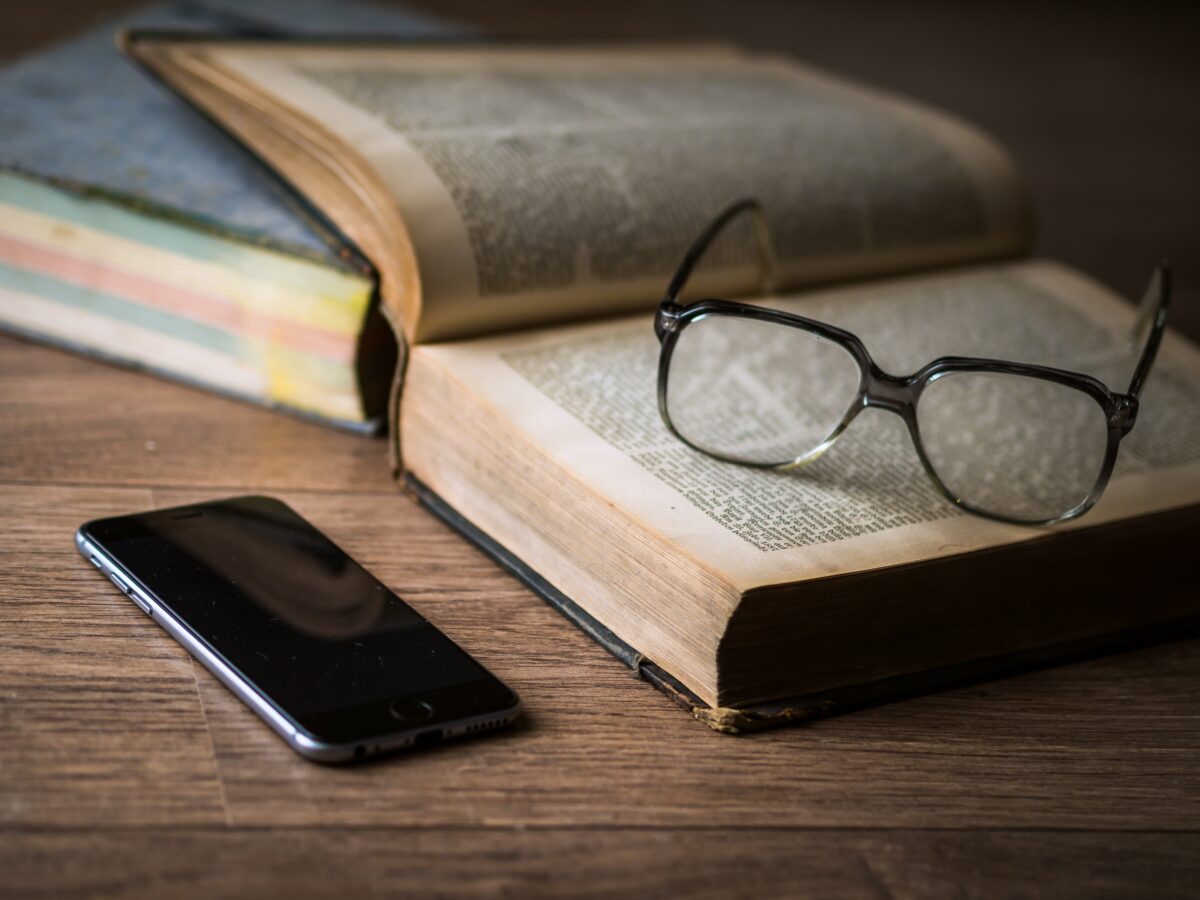
- Pixabay
Alle sind sich einig: Die Digitalisierung der Verwaltung muss vorangetrieben werden! Doch wie? Laut aktuellem Koalitionsvertrag soll die Verwaltung rein digital werden („digital only, mit gezielten Unterstützungsangeboten“). Marc Reinhardt von der Initiative D21 fordert gar explizit einen Abbau von analogen Ausweichmöglichkeiten.
Warum das keine gute Idee ist - ein Gastbeitrag von Laurent Pichler.
Digitale Dienste sind bereits jetzt meist nur mit einem internetfähigen Gerät nutzbar - unterwegs bedeutet das meist, auf ein Smartphone angewiesen zu sein. 95% der Menschen zwischen 14-49 nutzten 2023 ein Smartphone. Mit steigendem Alter sinkt der Anteil: Bei den 60-70-Jährigen sind es 85%, darüber nur noch 68%. Es gibt immer mehr Menschen, die versuchen, freiwillig auf ein Smartphone zu verzichten oder die Nutzung zu reduzieren. Jede*r Zweite sieht inzwischen seine*ihre Bildschirmzeit als problematisch an, mentale und körperliche Probleme (z. B. Haltungsschäden) werden oft auf das Smartphone zurückgeführt.
Für andere ist der Verzicht aber unfreiwillig: Für ältere Menschen ist die Bedienung oft ungewohnt. Sie haben besonders oft mit zusätzlichen Hürden, wie Sehbeeinträchtigungen, kognitiven oder feinmotorischen Einschränkungen zu kämpfen. Minderjährige können teils keine Apps installieren, selbst wenn der angebotene Dienst an sich keine Altersbeschränkung hat. Aber auch Menschen ohne festen Wohnsitz oder mit mangelnden Lese- und Schreibkenntnissen dürften Probleme mit der Nutzung haben.
Diesen vielfältigen Gründen, auf die Nutzung eines Smartphones zu verzichten, steht die Öffentliche Daseinsvorsorge gegenüber. Sie umfasst die Dienstleistungen, „derer der Bürger zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz unumgänglich bedarf“: Sei es der Zugang zu Bildungs- und Kultureinrichtungen, der öffentliche Nahverkehr oder der Eintritt ins Schwimmbad. Es handelt sich hier um besonders wichtige Leistungen eines Staates, die für die gesellschaftliche Teilhabe besonders wichtig sind - und die trotzdem mehr und mehr Menschen nicht mehr zur Verfügung stehen oder hinter Barrieren versteckt werden.
Denn analoge Fallback-Lösungen werden immer öfter nicht mehr oder nurmehr unter schlechten Bedingungen angeboten: Terminbuchungen bei einigen Ärzt*innen oder Ämtern gibt es nicht mehr telefonisch sondern nur noch über das Internet. Die Bahn verkauft rabattierte Tickets ausschließlich über Website oder App, versucht, ihre Fahrplahnaushänge zu reduzieren, sträubt sich dagegen, das Deutschland-Ticket oder die BahnCard ohne Smartphone-Pflicht anzubieten, und, wenn die Smartphone-freie Bürger*in trotz dieser Hürden beim Schwimmbad angekommen ist, steht sie teilweise vor verschlossenen Türen.
Die privaten Sharing-Mobilitätsanbieter, wie z. B. Free2move, MVG Rad, Lime, Callabike setzen ohnehin schon seit geraumer Zeit auf Smartphone-Only-Angebote. Nur noch der klassische öffentliche Nahverkehr ist ohne zusätzliche Gerätschaften nutzbar.
Zwei Ausprägungen von Digitalisierung
Doch wieso ist der App- und Smartphonezwang überhaupt nötig? Das Ticketing bei der Bahn ist sowieso vollständig digitalisiert, egal ob die Fahrkarte über die App oder am Schalter gekauft wurde. Der Kauf am Schalter ist also eigentlich auch „digital“. Für die Bahn macht es keinen Unterschied, ob das Ticket am Bildschirm oder in gedruckter Form vorgezeigt wird - nur die Anforderungen an die Nutzenden sind bei Nutzung der App höher.
Und wieso muss ich mir, um ein Fahrrad auszuleihen, erst eine App herunterladen, wenn ich auch einfach anrufen könnte?
„Digital“ bedeutet leider meist auch, dass die Nutzenden alleingelassen werden und nun alles selbst hinbekommen müssen, wo früher noch ein Mensch auf der anderen Seite war. Wenn die App gerade nicht funktioniert, hat man halt Pech gehabt.
Für die Nutzenden wäre es immer besser, hier mehr Wahlfreiheit zu haben - und sei es nur, weil die App oder das Internet vielleicht gerade nicht funktioniert.
Es geht auch anders, MVG-Rad!
Ein konkretes Beispiel: Über den Dienst MVG-Rad ist es eigentlich möglich gegen geringe Gebühr Fahrräder auszuleihen, die von der Münchner Verkehrsgesellschaft MVG bereitgestellt und gewartet werden. Die Räder können freistehend oder an Radstationen ausgeliehen und zurückgegeben werden. In den letzten Jahren ist der Dienst bis ins Umland expandiert.
Jedoch wird der Dienst nur über die App „MVGO“ zugänglich gemacht. Alternative Zugänge über NFC-Karten oder Service-Hotline werden - trotz bestehender technischer Möglichkeit - nicht zur Verfügung gestellt. Dies erhöht die Zugangshürden für einige Bevölkerungsgruppen für die Teilnahme an diesem öffentlich finanzierten Angebot.
Mit Appfree wird der Zugang zu Smartphone-Only-Diensten via herkömmlichem Telefonanruf ermöglicht. Exemplarisch wurde hierfür eine Telefonanbindung für den Fahrradverleih MVG-Rad der Münchner Stadtwerke geschaffen.
Das heißt, der*die Nutzende kann bei einer speziellen Telefonnummer anrufen und vollautomatisiert ein Fahrrad ausleihen. Es ist kein Smartphone und keine App nötig, sondern nur ein normales Telefon oder Tastenhandy. Technisch funktioniert das mithilfe von zwei Komponenten: Dem Telefonieserver Asterisk und einer PHP-Anwendung. Der Telefonieserver verbindet sich mit Hilfe eines Internet-Telefonie-Anbieters mit dem Telefonnetz und ist dann unter einer öffentlichen Telefonnummer erreichbar. Ruft man dort an, kann ein beliebiges MVG-Rad ausgeliehen werden, indem die Radnummer über die Telefontastatur eingegeben wird. Im Austausch erhält man eine PIN mitgeteilt, die das Rad freischaltet. Insgesamt wird so nicht nur ein öffentliches Angebot für mehr Menschen zugänglich gemacht, sondern auch ein digitaler Prozess in die analoge Welt zurückgeholt. Denn Digitalisierung muss nicht und sollte auch nicht bedeuten, Menschen auszuschließen.
Laurent Pichler
Laurent Pichler ist Full-Stack Web Developer in München und hat in Runde 16 des Prototype Fund das Projekt AppFree entwickelt.